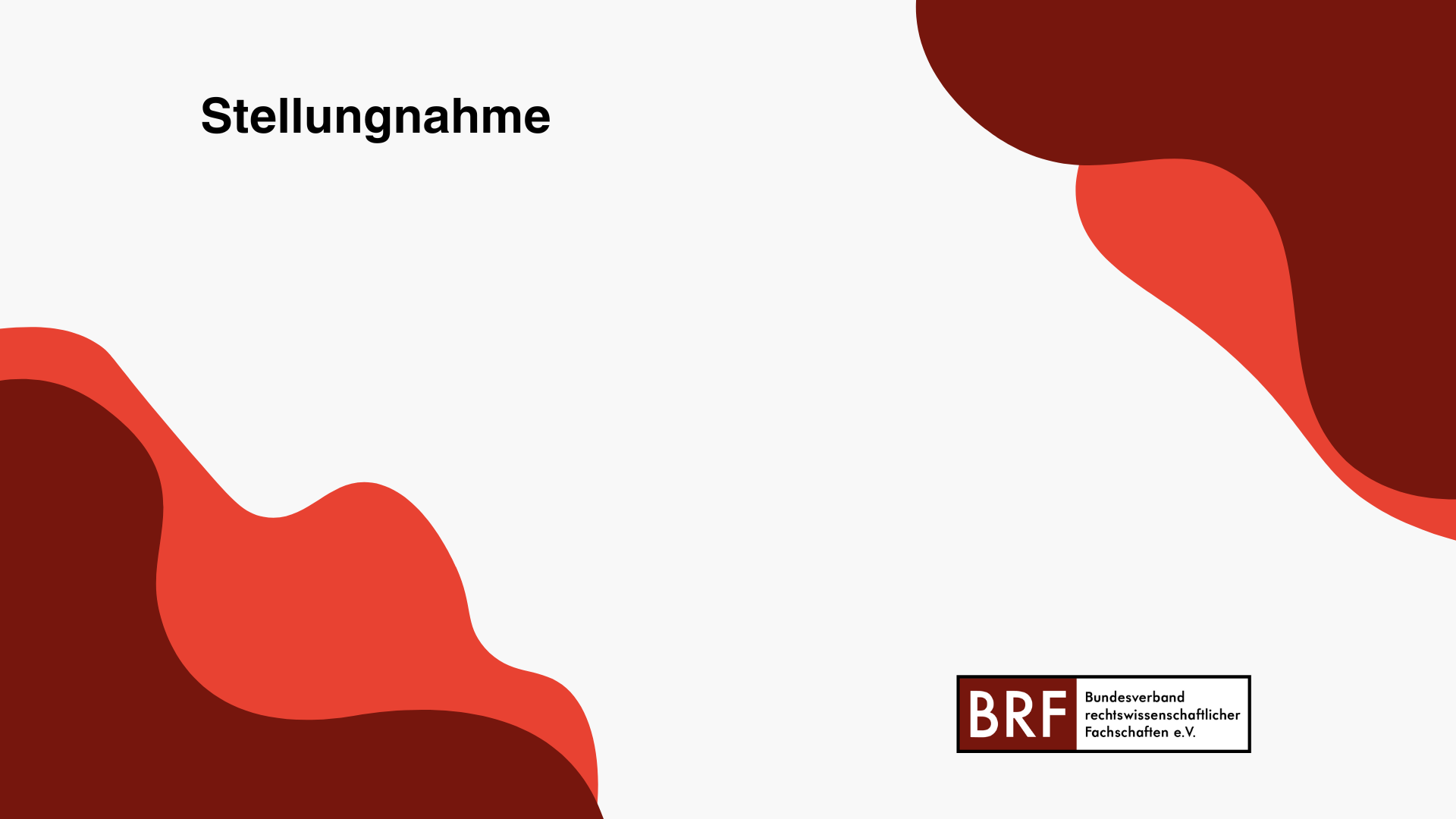25. Juli 2022
Der juristische Bachelor hat das Potenzial, einige Lücken in der juristischen Ausbildung zu schließen, die „klassische“ rechtswissenschaftliche Studiengänge häufig offenlassen. Dabei geht es um weitaus mehr als einen „Trostpreis“ für gescheiterte Jurastudierende. Hinter dem Bachelor steht noch so viel mehr, vor allem aber eine Grundsatzdebatte über die Ziele und Methoden der juristischen Ausbildung.
In Ihrem Artikel “Der Bachelor ist ein LoserAbschluss”, erschienen in der FAZ am 30.06.2022, stellt Frau Prof. Tiziana Chiusi, Vorsitzende des DJFT, den LL.B. als unnütze, gar die erfolgreiche Staatsexamenstradition gefährdende Forderung “selbst ernannter Reformer” dar. Der Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V., der die Interessen der knapp 120.000 Jurastudierenden in Deutschland vertritt, möchte dem ausdrücklich widersprechen: Die Diskussion um einen integrierten juristischen Bachelor zeigt eindeutig die Notwendigkeit struktureller Reformen der juristischen Ausbildung in der Bundesrepublik. Ein Bachelor kann dabei nur der Ausgangspunkt einer viel weitergehenden Reformdebatte sein, die die aktuellen Probleme umfassend angeht.
Warum braucht es Reformüberlegungen?
Die Qualität der juristischen Ausbildung in Deutschland wird von vielen Seiten angepriesen, so auch von Frau Prof. Chiusi. Doch Umfragen des Bundesverbandes rechtswissenschaftlicher Fachschaften und jüngste Studien zeigen ein anderes Bild: Die überwiegende Mehrheit der Studierenden ist unzufrieden mit dem Ausbildungsverlauf, aufgrund des Studiums spürbar psychisch belastet und würde es nicht weiterempfehlen.
Das allein indiziert einen klaren Handlungsbedarf, denn das aktuelle Modell vergrault den Nachwuchs. Gleichzeitig fehlen schon jetzt juristische Fachkräfte und dieser Mangel wird in den kommenden Jahren noch deutlicher zu spüren sein. Ausbildungsreformen sind daher nicht nur ein wünschenswerter Schritt für die Studierenden, sondern ein zwingend erforderlicher Schritt für den Staat.
Doch die Glorifizierung bestehender Ausbildungsstrukturen hemmt den Fortschritt. In ihren Grundzügen, wie der Zweistufigkeit, den Massenvorlesungen und den konzentrierten Abschussprüfungen, hat sich die juristische Ausbildung in den vergangenen Jahrzehnten nicht verändert. Ausschlaggebende Reformideen wie das sog. „Loccum“ konnten sich am Ende meist nicht durchsetzen. Selbst die eine große Reform der letzten Zeit die Einführung des Schwerpunktbereichsstudiums, wird immer wieder angegriffen. Dabei findet der von Frau Prof. Chiusi als Markenzeichen der deutschen juristischen Ausbildung hervorgehobene „Diskurs auf Augenhöhe“ vor allem in diesem Studienabschnitt statt, sehr selten jedoch in den klassischen Vorlesungen mit mehreren hundert Personen.
Stattdessen hat sich die juristische Ausbildung nur in eine Richtung verändert: Sie ist, begleitet von Europäisierung, Globalisierung und der stetig wachsenden Zahl relevanter Urteile immer mehr Instanzen, umfangreicher, detaillierter und dadurch komplexer geworden. Dies schlägt sich auf die staatlichen Prüfungen Auswendiglernen ist faktisch für die meisten Studierenden zum Standard geworden, da für strukturelle Herleitungen in fünf Stunden bei sehr umfangreichen Fällen kaum Zeit bleibt. Es wirkt daher zynisch, zu behaupten, Umfang des Prüfungsstoffes und Anforderungen werden verzerrt dargestellt. Auch die sich häufenden organisatorischen Mängel erschweren die Prüfungen. Viele Korrekturen sind zudem mangels eines Bewertungshorizontes einheitlichen subjektiv intransparent. Auch das Argument Frau Prof. Chiusis, dass am Ende nur 3,9 % der Kandidierenden abschließend durchfallen, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass etwa ein Viertel der Studierenden das Jurastudium insgesamt ohne Abschluss die Hochschule verlassen, viele von ihnen sogar erst nach dem zehnten Semester.
Die Forderung der Studierenden nach einem Auffangnetz scheint angesichts dessen ein logischer Schluss.
Ist der Bachelor eine Bedrohung?
Bei vielen Reformüberlegungen, so auch beim Bachelor, ist die Sorge groß, dass diese die Abschaffung des Staatsexamens bedeuten. Dies ist nicht im Interesse der Studierenden. So fordern wir beispielsweise den Erhalt einer Staatsprüfung explizit in unserem Grundsatzprogramm und die überwiegende Mehrheit der aktiven Jurastudierenden strebt auch mit LL.B. den staatlichen Abschluss an.
Eine Aufweichung des Staatsexamens ist auch nicht Zweck des Bachelors. Dieser ist vielmehr ein zusätzlicher Abschluss und soll bestehende nicht ersetzen. Dass Bachelor und Examen unterschiedliche Abschlüsse sind und sie zu unterschiedlichen Berufen befähigen, ist allen Befürworter:innen bewusst – entgegen Frau Prof. Chiusis Ansicht auch denjenigen, die aus Familien ohne juristischen Hintergrund kommen.
Besondere Zugangsvoraussetzungen zu bestimmten juristischen Berufen wird es immer geben und es gibt sie auch in anderen Staaten, deren universitäre Ausbildung ausschließlich auf Bologna beruht. Bestehen tatsächlich ernsthafte Zweifel daran, dass das klassische Examen einen Bachelor nicht überlebt, sollte eher an der Qualität der Abschlussprüfungen als gegen den Bachelor gearbeitet werden. Das krampfhafte Festhalten an der jetzigen Ausgestaltung des Staatsexamens und der Ausbildung erweckt dagegen gelegentlich den Anschein als ginge es dabei nur um den Selbsterhalt einer exklusiven Spezies.
Dabei darf nicht verkannt werden, dass die Jurist:innen, die heute nachgefragt werden, längst nicht mehr nur Volljurist:*innen sind. Das Recht ist heute in vielen Bereichen ohne juristische Bildung kaum verständlich, dennoch müssen beispielsweise auch Kleinstunternehmen mit Website oder private Blogger Vorgaben des TMG, TTDSG und der DSGVO erfüllen. Ihnen das richtige Handwerkszeug mitzugeben, erfordert rein fachlich keine zwei Staatsprüfungen. Für Unternehmen sind außerdem interdisziplinär ausgebildete Personen interessant, die – im Gegensatz zu den klassischen Volljurist:innen – neben Rechtskenntnissen auch eine direkte Verbindung zu anderen Disziplinen wie Informatik, Psychologie oder BWL (Stichwort Wirtschaftsjurist:innen) vorweisen können. Wir sollten uns daher davor hüten, nur Volljurist:innen als „richtige“ Jurist:innen zu bezeichnen, denn unser Anwendungsfeld reicht mittlerweile viel weiter als die zwei Examina.
Der LL.B. kann für Berufe in supranationalen oder Nicht-Regierungs-Organisationen qualifizieren. Weiterhin sind Tätigkeiten im diplomatischen Dienst, im Journalismus, in der Politik, in der Lehre, in Forschungseinrichtungen und eben in Unternehmen denkbar. Eine andere Möglichkeit ist die Absolvierung eines LL.M. im Ausland, basierend auf dem deutschen LL.B., wodurch sogar die Arbeit in Kanzleien möglich wird. Im Zweifel ist der Bachelor schlicht ein Hochschulabschluss, der für gewisse Berufe vorausgesetzt wird und der nicht erst nach abgebrochenem Jurastudium in drei Jahren weiterer Arbeit nachgeholt werden muss.
Berufschancen bietet der Bachelor somit mehr als genug, um eine Existenzberechtigung zu haben. Der Nachwuchsmangel ist weiterhin so hoch und das Anforderungstableau derart divers, dass auch ein Markt für solche Jurist:innen besteht. Die angeblich mangelnde Nachfrage nach LL.B.-Absolvent:innen kann als Gegenargument daher nicht angeführt werden.
Kann der Bachelor diesen Reformbedarf liefern?
Der integrierte juristische Bachelor ist nicht bloß ein Zwischenabschluss, sondern kann das rechtswissenschaftliche Studium auch inhaltlich bereichern. Welche Vorteile der LL.B. noch mit sich bringt, wird jedoch in der Einführungsdebatte häufig verkannt.
Die Angliederung an das ECTS-System, auf dem das Bologna-Modell aufbaut, ermöglicht interdisziplinären Austausch, indem fachfremde oder fächerübergreifende Studienleistungen besser berücksichtigt werden können als bisher.
Eine Orientierung an der Arbeitsweise bei Bachelorarbeiten kann zudem den wissenschaftlichen Austausch fördern. Im Jurastudium ist es nicht unüblich, dass Studierende ihre Schwerpunktarbeiten auf sich allein gestellt und unter Geheimhaltung ihres Themas anfertigen müssen. Dies ist das Gegenteil von einem „Diskurs auf Augenhöhe“. Bei klassischen Bachelorarbeiten scheint ein gleichgestellter Austausch weitaus wahrscheinlicher als in unseren Schwerpunktbereichen oder den dem Selbstverständnis des Jurastudiums entsprechenden Massenvorlesungen.
Weiterhin ermöglicht der Bachelor den Studierenden mehr Flexibilität, da sie sich nicht zu Beginn des Studiums zwischen LL.B. oder Staatsexamen entscheiden müssen. Diese Entscheidung können zu diesem Zeitpunkt ohnehin die wenigsten abschließend treffen, denn die beruflichen Wünsche und Ziele können sich im Laufe der Ausbildung stark verändern. Und wenn sich durch das Auffangnetz Bachelor mehr Studierende an die staatlichen Prüfungen herantrauen, da sie bereits einen Abschluss sicher haben, kann so auch dem Nachwuchsmangel entgegengewirkt werden.
Der Bachelor ist zudem dazu geeignet, mehr Chancengleichheit zu schaffen und dadurch diverser zu werden. Das Jurastudium bis zum Examen ist nicht günstig und sehr zeitintensiv. Für finanziell schwächere Personen wird das rechtswissenschaftliche Studium mit der Aussicht auf den LL.B. deutlich attraktiver, wenn dadurch die Gefahr minimiert wird, am Ende ohne Abschluss, aber mit hohen Ausgaben, dazustehen.
Indem sich die Gesamtnote des Bachelors anteilig aus sämtlichen Prüfungsleistungen während des Studiums zusammensetzt, wird ein Anreiz für Studierende geschaffen, von der „viergewinnt-Mentalität“ Abstand zu nehmen und vor dem Repetitorium nicht nur sporadisch zu lernen. Dadurch werden diese Leistungen im Studium auch angemessen durch einen Abschluss honoriert, was aktuell leider auf der Strecke bleibt. Kritiker:innen, die behaupten, die Leistungen im Jurastudium könnten keinen Bachelor rechtfertigen, sei hier entgegengehalten, dass die Qualität der Ausbildung ernsthaft zu hinterfragen ist, wenn wir demzufolge in den ersten drei Jahren ohnehin nichts Nennenswertes erlernen. Zu guter Letzt ermöglicht der Bachelor die Senkung des psychischen Drucks, indem er dem „alles-oder-nichts-Charakter“ der Staatsprüfung entgegengewirkt wird. Diese Entlastung ist angesichts der Unzufriedenheit der Studierenden und des Nachwuchsmangels zwingend erforderlich.
Und nun?
Am Ende kann der LL.B. nicht alle Probleme der juristischen Ausbildung lösen. Vielmehr braucht es einen grundsätzlichen Kulturwandel in der Rechtswissenschaft, indem wir uns von einem elitären Selbstverständnis und starkem Konkurrenzdenken verabschieden. Doch Frau Prof. Chiusi hat dieses Bild von Jurist:innen mit der Wortwahl und dem Ton ihres Artikels leider eher verstärkt. Wir sollten stattdessen für ein flexibles, kooperatives und ermutigendes Studium einstehen, für das sich junge Menschen begeistern können und das den gesellschaftlichen Realitäten gerecht werden kann.
Der Bachelor ist für uns ein wichtiger Zwischenschritt auf diesem Weg zu einer besseren Ausbildung. Dass ein solcher problemlos und ohne große Umstellungen des Studienplans in das bisherige Studium integriert werden kann, zeigen all die Fakultäten, die sich bereits für den LL.B. entschieden haben. Wir sollten diesen Schritt daher einfach wagen!