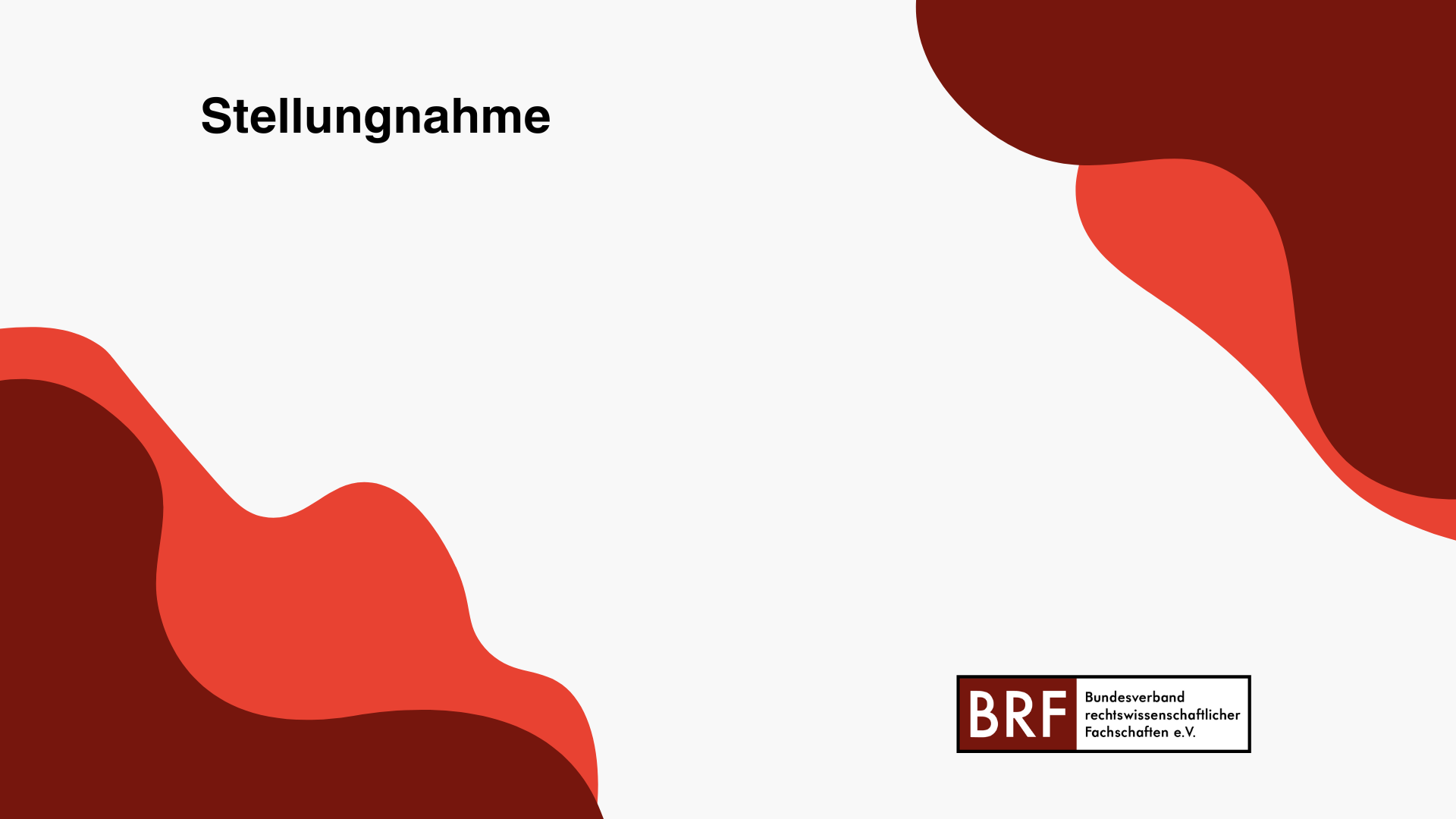24. November 2019
Auf der 90. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister am 7. November 2019 wurde beschlossen, „wegen der Verschiedenartigkeit der staatlichen Pflichtfachprüfung und der universitären Schwerpunktbereichsprüfung künftig auf die Bildung einer Gesamtnote zu verzichten und im Zeugnis über die erste Prüfung beide Noten getrennt auszuweisen“. Die Ministerinnen und Minister stellen sich dabei in ungewohnter Deutlichkeit gegen den vorbereitenden Bericht des Koordinierungsausschusses und die nahezu einhellige Position der Betroffenen. Auch aus Studierendensicht muss der Beschluss gleich aus mehreren Gründen als verfehlt angesehen werden.
Ziel der Diskussion um eine Reform des Schwerpunktstudiums war es, die festgestellte Uneinheitlichkeit in Prüfungsanforderungen und Leistungsbewertung im Schwerpunktstudium zu verringern. Dieser Befund wird von der Mehrzahl der Absolventinnen und Absolventen und vom BRF in seiner Grundlage geteilt.
Der beschlossene Verzicht auf die Bildung einer Gesamtnote erweist sich jedoch als ungeeignet, um dieses Ziel zu erreichen. Selbst das Professorium der Universität Heidelberg, auf das das Modell zurückzuführen ist, gibt zu, dass ihr Modell nicht auf die Erhöhung der Vergleichbarkeit der Schwerpunkte gerichtet sei. Vielmehr geht es dem „Heidelberger Modell“ um eine Reduktion der Bedeutung der Schwerpunktbereichsnote.
Die Übernahme dieses Modells gefährdet die Zielsetzungen, die 2002 mit der Einführung des Schwerpunktbereichsstudiums verfolgt und weitestgehend erreicht wurden. So ermöglicht der Schwerpunkt den Studierenden die Wahl der Studieninhalte nach der persönlichen Neigung und damit bereits im Studium eine Spezialisierung. Die dagegen vielfach geäußerte Hypothese, die Wahl der Schwerpunkte erfolge nicht nach Neigung, sondern nach Noten, lässt schon anhand der Schwerpunktstatistik des Deutschen Juristen-Fakultätentages5 ohne große Mühe widerlegen. Zudem ermöglicht die Wahl der Schwerpunkte den Studierenden ein vertieftes wissenschaftliches Arbeiten, wie es in den sonstigen Studienabschnitten nicht verlangt wird. Der Schwerpunkt ermöglicht somit die einzige Chance, sich außerhalb einer Promotion wissenschaftlich mit dem Recht zu beschäftigen. Dabei bietet die Relevanz der Schwerpunktnote für das Abschlusszeugnis zugleich Ansporn und Belohnung für erbrachte Leistungen. Der Verzicht auf eine Gesamtnote führt zum Wegfall dieser positiven Effekte und reduziert die Motivation der Mehrzahl der Studierenden. Der wissenschaftliche Anspruch des Studiums droht somit in der Breite verloren zu gehen.
Der Beschluss der Justizministerkonferenz erweist sich überdies als unverhältnismäßig, indem er nur die Symptome der Uneinheitlichkeit überdeckt, ohne sich an einer Behebung der Ursachen zu versuchen. Genau hierzu hatte der Koordinierungsausschuss selbst Vorschläge zur Vereinheitlichung der Prüfungsformate und Stärkung der Transparenz der Schwerpunktnote angeregt. Diese Vorschläge können die geschilderten Fehlentwicklungen bekämpfen, ohne die Motivation der Studierenden und die Wissenschaftlichkeit des Studiums zu gefährden. Unter Ablehnung der bereits 2017 beschlossenen Absenkung der Stundenzahl auf 10-14 SWS, schließt sich der Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften daher, trotz kleineren Differenzen im Detail, den Ausführungen des Koordinierungsausschusses auf S. 31-48 des Berichts und der abschließenden Beschlussempfehlung ausdrücklich an.
Das von der Justizministerkonferenz beschlossene Modell findet mit Ausnahme des Professoriums in Heidelberg keine Unterstützung unter den befragten Fakultäten oder Berufsverbänden. Vielmehr wird es von den meisten Befragten ausdrücklich abgelehnt. Selbst Gegner des Schwerpunktstudiums wie der Deutsche Anwaltverein (DAV) lehnen das „Heidelberger Modell“ in konsequenter Verfolgung ihres Ziels mangels Geeignetheit im Ergebnis ab. Die vereinzelten befürwortenden Argumente kommen nicht nur weitgehend aus Heidelberg selbst, sondern werden schon durch die Stellungnahmen der anderen Fakultäten widerlegt. Besonders zynisch erscheint die Annahme, durch den Verzicht auf eine einheitliche Gesamtnote werde der im Schwerpunktbereich bestehende Druck für die Studierenden verringert. Diese ignoriert schlicht, dass der psychische Druck im Studium in der Pflichtfachprüfung anzusiedeln ist und durch die vollständige Konzentration auf den Pflichtstoff gerade erhöht wird. Daher ist es wenig verwunderlich, dass das „Heidelberger Modell“ ausschließlich vom dortigen Professorium vertreten und von der Fachschaft Jura Heidelberg ausdrücklich abgelehnt wird. Das trotz dieser massiven Kritik aller Betroffenen erfolgte Votum der Justizministerkonferenz kann nur mit dem Versuch begründet werden, einen Kompromiss zwischen Befürwortern und Gegnern des Schwerpunktstudiums zu finden. Herausgekommen ist ein „fauler Kompromiss“ und ein Ergebnis, das für die Betroffenen nicht nur im Vergleich zur Beschlussvorlage des Koordinierungsausschusses, sondern auch zum – abzulehnenden – Votum des DAV nur Nachteile mit sich bringt.
So würde das Schwerpunktstudium im nationalen Bereich vermutlich nahezu keine Auswirkungen auf spätere Berufschancen oder die Bewerbung auf internationale Studienplätze mehr entfalten. Vielmehr würde es zu einem bloßen Anhängsel im Studium, dessen Aufwand weder für juristische Fakultäten noch für die Studierenden in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Nutzen stünde. Der Schwerpunkt wird so mittelfristig noch stärker in die Kritik geraten und am Ende eines neuen Diskussionsprozesses dürfte die Abschaffung des Schwerpunktstudiums stehen. Damit leitet der Beschluss der Justizministerinnen und Justizminister eine Rolle rückwärts in das letzte Jahrtausend ein, anstatt die Erfordernisse der Zukunft anzugehen. Es ist schwer vorstellbar, dass sich die zukünftigen Abiturientinnen und Abiturienten in großen Zahlen für ein Studium entscheiden werden, das in seinem Aufbau dem Studienverlauf ihrer Großeltern entspricht und ihnen über fünf Jahre keine ernsthaften Möglichkeiten lässt, ihren persönlichen Neigungen nachzugehen und ein Rechtsgebiet ihrer Wahl wissenschaftlich zu hinterfragen. Die Justizministerinnen und Justizminister sollten beachten, dass neben „Recht“ auch das Wort „Wissenschaft“ in der Studiengangsbezeichnung steht. Der bei den Justizministerien spürbare Mangel an Nachwuchs dürfte sich mit einer Senkung der Attraktivität des Studiums verstärken.
Um den Nachwuchsmangel zu bekämpfen und das Studium attraktiv zu machen, muss das bei Studierenden und Absolvent*innen beliebte Schwerpunktstudium daher beibehalten und weiterentwickelt werden. Der Vorschlag des Koordinierungsausschusses, der die positiven Aspekte des Schwerpunktstudiums herausstellt und eine Vergleichbarkeit der Prüfungsleistungen schafft, stellt hierfür einen guten Weg dar. Er erhält das bisherige Gleichgewicht zwischen wissenschaftlicher Ausbildung und Falllösungstechnik und schafft durch eine Offenlegung der Notengrundlage und der Studieninhalte ebenso wie durch die Zugänglichkeit der Schwerpunktstatistik des Deutschen Juristen-Fakultätentages für Arbeitgeber*innen eine unproblematische Möglichkeit, die Schwerpunktnote einzuordnen.