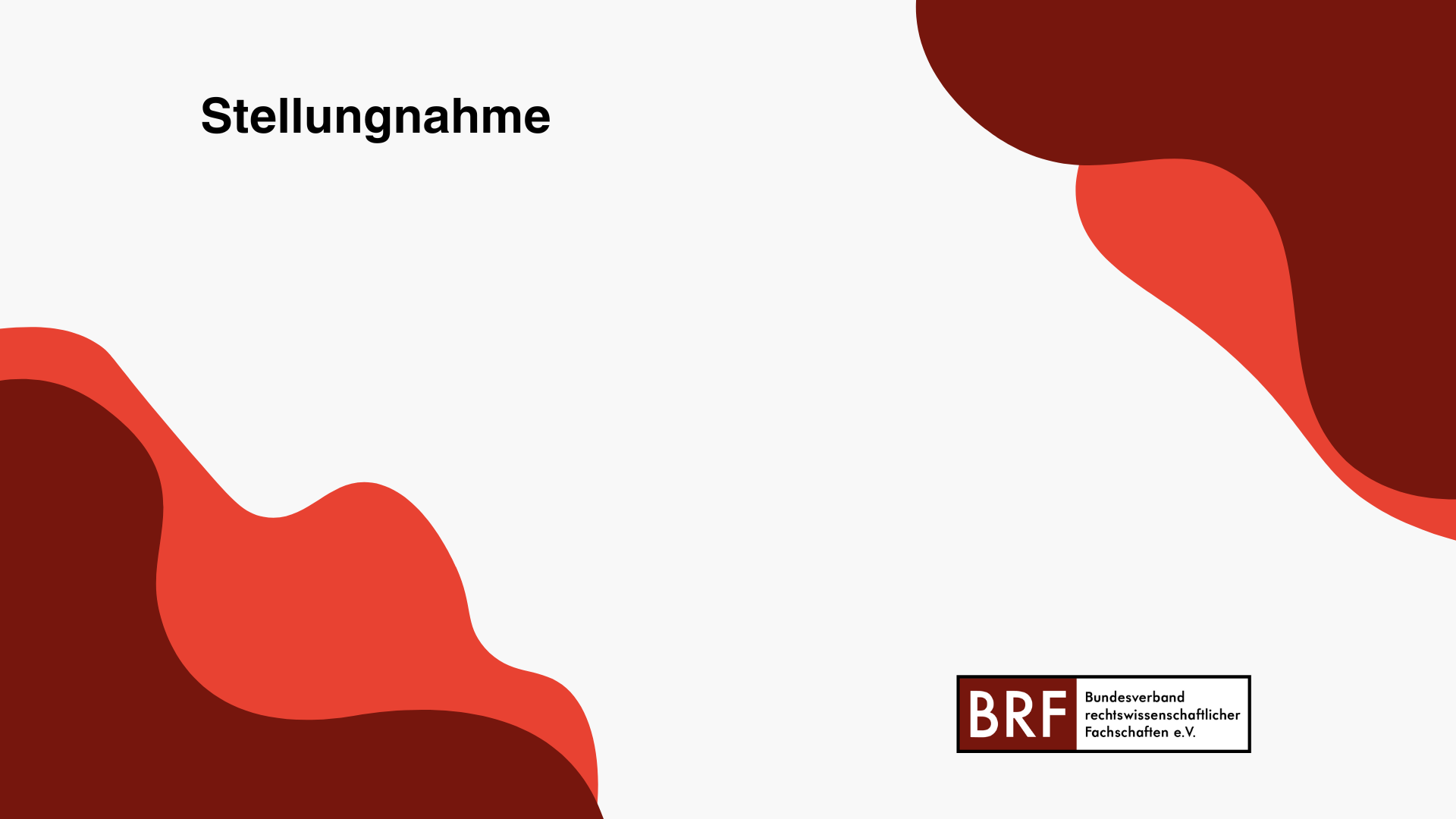06. Februar 2024
Mit der Einführung eines integrierten Bachelor of Laws wird in Nordrhein-Westfalen ein wichtiger Schritt unternommen, das rechtswissenschaftliche Studium zukunftsfähiger zu gestalten. Ein in das Studium der Rechtswissenschaften integrierter Abschluss kann den psychischen Druck in der staatlichen Pflichtfachprüfung senken, honoriert die bereits erbrachten Leistungen der Studierenden und sorgt gleichzeitig mit der Verleihung eines Abschlusses, der nicht das Bestehen der staatlichen Pflichtfachprüfung voraussetzt, für eine nachhaltigere Verwendung der Ressourcen der Hochschulen. Dennoch weist der Gesetzesentwurf stellenweise Verbesserungspotential auf.
1. Erfordernis der Exmatrikulation
Die Tatsache, dass die Studierenden nicht vor die Wahl gestellt werden, einen Abschluss in Form des Bachelor of Laws verliehen zu bekommen oder die erste Prüfung zu absolvieren, ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Durch das in § 66 Abs. 1a Satz 3 HG E2 normierte Erfordernis der Exmatrikulation vor Stellung des Antrags bleibt man jedoch in Nordrhein-Westfalen hinter den Möglichkeiten eines integrierten Bachelor of Laws zurück.
Da eine bestandene erste Prüfung im Vergleich zu einem Bachelor of Laws höher zu gewichten ist, gibt es für Absolvent:innen der ersten Prüfung keinen logischen Grund, zusätzlich die Verleihung eines Bachelorabschlusses zu beantragen. Wird eine Karriere abseits der klassischen juristischen Berufe angestrebt, haben Absolvent:innen außerdem die Möglichkeit, sich gem. § 66 Abs. 2 HG einen Mastergrad verleihen zu lassen. Der in das Studium integrierte Bachelor of Laws ist aufgrund des Exmatrikulationserfordernisses somit nur für die Personen attraktiv, die sich für eine Beendigung des Studiums entscheiden, ohne sich zur staatlichen Pflichtfachprüfung zu melden oder diese nicht bestehen.
Ein integrierter Bachelor of Laws wird in einigen Kreisen fälschlicherweise noch immer als „minderwertiger“ Abschluss und im Vergleich zur bestandenen ersten Prüfung als wertlos angesehen. Hier besteht die Gefahr, dass ein Abschluss, der erbrachte Studienleistungen unabhängig von der Ablegung der staatlichen Pflichtfachprüfung honoriert und dieser Prüfung den „alles-oder-nichts“Charakter nehmen sollte, vielmehr zu einem Indikator für das Nichtablegen oder -bestehen der staatlichen Pflichtfachprüfung führen könnte.
Neben dieser Gefahr einer negativen Assoziation werden gleichzeitig viele positive Aspekte eines integrierten Abschlusses nicht genutzt.
Ein akademischer Abschluss in Form eines Bachelor of Laws bietet Studierenden, die in der Zeit der Vorbereitung auf die staatliche Pflichtfachprüfung oder in der Zeit zwischen Anfertigung der Aufsichtsarbeiten und mündlichem Teil einer Erwerbstätigkeit nachgehen (müssen), die Möglichkeit, für ihre Tätigkeit höher entlohnt zu werden und somit bei gleichbleibendem Einkommen mehr Zeit in die Prüfungsvorbereitung investieren zu können. Wissenschaftliche Hilfskräfte mit Bachelorabschluss (WHB) erhalten derzeit beispielsweise an der Universität zu Köln einen Bruttostundenlohn von 13,57 €, während Hilfskräfte ohne Bachelorabschluss (SHK) 12,41 € brutto pro Stunde erhalten.3 ihre Tätigkeit höher entlohnt zu werden und somit bei gleichbleibendem Einkommen mehr Zeit in die Prüfungsvorbereitung investieren zu können. Wissenschaftliche Hilfskräfte mit Bachelorabschluss (WHB) erhalten derzeit beispielsweise an der Universität zu Köln einen Bruttostundenlohn von 13,57 €, während Hilfskräfte ohne Bachelorabschluss (SHK) 12,41 € brutto pro Stunde erhalten.
Soll nach Erhalt des Bachelorabschlusses ein Masterstudium aufgenommen werden, müssen sich die Studierenden zuerst exmatrikulieren, im Anschluss den Antrag auf Verleihung eines Bachelor of Laws stellen und können sich erst im Anschluss für einen Masterstudiengang bewerben. Die Folge ist ein Semester, in dem weder studiert noch eine finanzielle Förderung bezogen werden kann – ein Umstand, dem ohne das Erfordernis der Exmatrikulation leicht entgegengewirkt werden könnte.
Daneben müssen die Prüflinge zwar nicht zwangsläufig an einer Hochschule eingeschrieben sein, um die staatliche Pflichtfachprüfung absolvieren zu können, zur Nutzung des universitären Repetitoriums oder Belegung eines universitären Klausurenkurses jedoch schon.
Die vermeintliche Kehrseite der Verleihung eines Bachelor of Laws während eines laufenden Studiums ist der Wegfall der Förderung nach dem BAföG bei Erwerb eines Hochschulabschlusses (§ 7 Abs. 1 Satz 1 BAföG). Dem ist jedoch der § 7 Abs. 1b BAföG entgegenzuhalten, der ausdrücklich die Fortführung der Ausbildungsförderung für Studiengänge, die ganz oder teilweise mit einer staatlichen Prüfung abschließen, vorsieht. Der Bundesgesetzgeber hatte bei der Einführung der Norm auch insbesondere die integrierten Bachelorabschlüsse im Rechtswissenschafts- und Medizinstudium vor Augen.
§ 7 Abs. 1b Satz 2 BAföG verlangt, „dass der Studiengang durch Studien- oder Prüfungsordnung in der Weise vollständig in den Staatsexamensstudiengang integriert ist, dass innerhalb der Regelstudienzeit des Bachelor- oder Bakkalaureusstudiengangs auch sämtliche Ausbildungs- und Prüfungsleistungen zu erbringen sind, die für den Staatsexamensstudiengang in der Studien- oder Prüfungsordnung für denselben Zeitraum vorgesehen sind.“ Die Anerkennung einer engen, integrativen Verknüpfung der Studiengänge erfordert insbesondere, dass die Studienordnung darauf ausgerichtet ist, die Studiendauer im Staatsexamensstudiengang durch das integrierte Studium mit Bachelorabschluss im Vergleich zum reinen Studiengang mit dem Abschluss erste Prüfung ohne zusätzlichen Bachelorabschluss nicht zu verlängern;5 eine einheitliche Prüfungsordnung ist dabei jedoch nicht erforderlich.6 Der Erwerb eines integrierten Bachelors soll demnach schlichtweg nicht zur Verlängerung des Studiums mit staatlicher Abschlussprüfung führen.
Zwar setzt die Norm eine vollständige Integration des (Bachelor-)Studiengangs durch Studien- oder Prüfungsordnung voraus, dem Gesetzgeber war die Möglichkeit der Einführung eines Abschlusses kraft Gesetzes allerdings zum Zeitpunkt der Verabschiedung noch gar nicht bewusst.7 Bislang genügen schon Studien- oder Prüfungsordnungen – deren Voraussetzung nicht einmal identische Module, sondern lediglich das Absolvieren der Module des Bachelorstudienganges ohne eine Verlängerung der Studiendauer des Studiengangs mit staatlichem Abschluss sind – den Anforderungen des § 7 Abs. 1b Satz 2 BAföG. Vor diesem Hintergrund muss die Regelung erst recht für einen Abschluss gelten, der gar keine eigenen Ausbildungs- und Prüfungsleistungen voraussetzt und für dessen Verleihung das Absolvieren der für den Studiengang mit dem Abschluss erste Prüfung vorgesehenen Prüfungsleistungen maßgeblich ist.
Ein Wegfall der Förderung kann in diesem Fall nicht intendiert und sollte somit auch nicht zu befürchten sein. Wie bereits aufgezeigt, geht die verpflichtende Exmatrikulation für die Studierenden ausschließlich mit Nachteilen einher. Daher ist dringend zu empfehlen, von dem Erfordernis der Exmatrikulation vor Stellung des Antrages auf Verleihung eines Bachelor of Laws abzusehen.
2. Nachträgliche Verleihung
Die in § 66 Abs. 1a Satz 1 HG E vorgesehene Möglichkeit einer nachträglichen Verleihung des Bachelor of Laws ist grundsätzlich zu befürworten. Ferner ist es vor dem Hintergrund, dass Abbrecher:innen und Personen, die die staatliche Pflichtfachprüfung endgültig nicht bestehen, sich nach einigen Jahren bereits anderweitig beruflich orientiert haben werden, nachvollziehbar, den Rückwirkungszeitraum zu begrenzen. Die Möglichkeit der Verleihung eines Bachelorgrades kommt vor allem den (ehemaligen) Studierenden zugute, die sich nach einem abgebrochenen oder endgültig nicht bestandenen Studium noch nicht anderweitig fortgebildet haben und für deren berufliche Perspektive ein Bachelor of Laws noch hilfreich sein könnte. Der angedachte Zeitraum für die Rückwirkung der Regelung ist hier – besonders vor dem Hintergrund der Einschränkungen im Studium durch die COVID-19-Pandemie – nicht weit genug gewählt.
Während der Pandemie war das Studieren aufgrund vieler Faktoren, darunter die Umstellung auf digitale Lehre, die Schließung der Bibliotheken und die mentale Belastung aufgrund der notwendigen sozialen Distanzierung, nur schwer oder stark eingeschränkt möglich. Aus diesen Gründen wurde für die betroffenen Semester die individuelle Regelstudienzeit erhöht und die Nichtanrechnung von vier Semestern auf den Freiversuch beschlossen. Daher konnten sich Studierende zunächst darauf verlassen, dass ihnen bei Nichteinhaltung des Studienverlaufsplanes innerhalb der betroffenen Semester kein Wegfall bestehender Förderungen nach dem BAföG oder des Freiversuches drohen würde.
Unter Einbeziehung der vier Semester, die bei der Berechnung der Semesteranzahl für die Wahrnehmung des Freiversuchs aufgrund der COVID-19-Pandemie unberücksichtigt bleiben und unter Wahrung der Regelstudienzeit im vorgesehenen Studienverlaufsplan gibt es Studierende, die bereits vor dem 31.03.2019 die Zulassungsvoraussetzungen zur staatlichen Pflichtfachprüfung erfüllt haben können. Diese befänden sich bei erfolgreicher Absolvierung des Schwerpunktbereichsstudiums und Wahrnehmung des Freischusses im Wintersemester 2023/24 im regulären Erstversuch der staatlichen Pflichtfachprüfung. Für diese Studierenden stünde zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, ob sie die staatliche Pflichtfachprüfung endgültig nicht bestehen – dennoch wäre für sie die Beantragung eines Bachelor of Laws schon nicht mehr möglich.
Das frühe Erfüllen aller Zulassungsvoraussetzungen für die staatliche Pflichtfachprüfung sowie die Pausierung des Studiums während der COVID-19-Pandemie dürfen sich auch im Falle der stichtagsgebundenen Verleihung eines Bachelor of Laws nicht zum Nachteil der Studierenden auswirken. Daher wird empfohlen, den Stichtag auf den 31.03.2017 zu legen, um die geplante Frist von fünf Jahren um die im Rahmen der individuellen Regelstudienzeit anerkannten vier Semester zu verlängern.
Außerdem kann der Zeitpunkt des Vorliegens der Voraussetzungen von der individuellen Entscheidung der Studierenden, erst die Schwerpunktbereichsprüfung oder erst die staatliche Pflichtfachprüfung zu absolvieren, abhängig sein. Um ein zufälliges Herausfallen aus dem Rückwirkungszeitraum zu vermeiden, ist zudem zu empfehlen, dass das Vorliegen einer der beiden Voraussetzungen für die Stellung des Antrages vor dem Stichtag unschädlich ist.
Schließlich darf die Beantragung des Bachelor of Laws für die Studierenden auf keinen Fall mit zusätzlichen Kosten, beispielsweise in Form einer Antragsgebühr, verbunden sein.
3. Anerkennung und Qualitätssicherung
Zwar bringt eine Einführung kraft Gesetzes einige Vorteile, wie beispielsweise das beschleunigte Verfahren, geringere Kosten bei der Umsetzung und eine bessere Vergleichbarkeit der Abschlüsse innerhalb des Landes Nordrhein-Westfalens mit sich. Der Verzicht auf eine Akkreditierung darf Absolvent:innen jedoch nicht schlechter stellen: In jedem Fall muss sichergestellt werden, dass der verliehene Bachelor of Laws einen vollwertigen Abschluss darstellt, der nicht aufgrund der fehlenden Modularisierung der Studiengänge und einer nicht festgelegten ECTS-Zahl als nicht ausreichend für die Aufnahme eines konsekutiven Masterstudiengangs angesehen wird oder der Zugang zu Berufen verwehrt wird, deren Ausübung mit einem akkreditierten Bachelor of Laws möglich wäre.
Unabhängig davon wird bei einem Verzicht auf die Akkreditierung eines Studiengangs die Möglichkeit, die Inhalte des Studienganges durch Gutachter:innen überprüfen zu lassen und alle Statusgruppen über die Modalitäten der Verleihung hinaus zu beteiligen, nicht genutzt. Daneben ist anzumerken, dass die Definierung notwendiger Qualifikationen kraft gesetzlicher Regelung nicht automatisch die Gewährleistung der Qualitätssicherung zufolge hat. Auch die in § 84 Abs. 7 HG E vorgesehene Evaluation eines Gesetzes wird dieser Praxis nicht gerecht. Dieser Lücke sollte man sich bewusst sein und versuchen, sie durch alternative Qualitätssicherungsinstrumente zu schließen.
4. Notenumrechnung
§ 66 Abs. 1a Satz 3 HG E enthält eine Verordnungsermächtigung für den Erlass einer die Grundsätze für die Berechnung der Bachelornote regelnden Rechtsverordnung. Eine Umrechnungstabelle, die für alle Hochschulen in einem Bundesland gilt, ist aufgrund der dadurch entstehenden Vergleichbarkeit der Bachelornoten zu begrüßen.
Da die Bewertung nach der juristischen Punktskala einem anderen Maßstab unterliegt, sollte eine Umrechnung in Dezimalnoten auf keinen Fall ohne eine Berücksichtigung der Besonderheiten der juristischen Punkteskala stattfinden. Bewertungen im Bereich von „sehr gut“ auf der juristischen Punkteskala werden nur von etwa 6 % Prozent der Absolvent:innen erreicht, während ein „sehr gut“ im Bologna-System deutlich häufiger vergeben wird.8 Das führt bei einer gradlinigen Umrechnung der Punktzahlen zu vergleichsweise schlechten Bachelornoten. So reicht ein in der juristischen Ausbildung überdurchschnittlich gutes Ergebnis von etwa neun Punkten nur für eine durchschnittliche Bachelornote von 2,3. Gerade vor dem Hintergrund, dass an anderen Hochschulen für integrierte Bachelor of Laws weniger strenge Umrechnungsschlüssel angewendet werden und nicht-integrierte Bachelor das Problem der Umrechnung nicht zu lösen haben, wirkt sich eine solche Note besonders dann zum Nachteil der Absolvent:innen aus, wenn potenzielle Arbeitgeber:innen nicht mit der juristischen Notenskala vertraut sind. Die fehlende unmittelbare Vergleichbarkeit sollte bei der Erstellung einer Umrechnungstabelle daher in jedem Fall beachtet werden.
Daneben ist jedoch anzumerken, dass bei Erlass einer Rechtsverordnung keine Möglichkeit zur Stellungnahme der universitären Statusgruppen zu einem etwaigen Umrechnungsschlüssel – wie es im Rahmen eines Akkreditierungsverfahrens der Fall wäre – vorgesehen ist. Beim Erlass einer solchen Rechtsverordnung wäre eine Beteiligung weiterer Akteur:innen, beispielsweise im Form eines Anhörungs- oder Abstimmungserfordernisses, sinnvoll.
5. Klarstellungen im JAG NRW
Im Falle der Klarstellungen in § 7 Abs. 3 JAG NRW E, § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 JAG NRW E und § 56a Abs. 2 Satz 1 JAG NRW E sowie die eingeführte Möglichkeit des Verzichts auf die Durchführung der Wiederholung der staatlichen Pflichtfachprüfung zum Zwecke der Notenverbesserung in § 26 Abs. 3 JAG NRW E ist die dadurch geschaffene Rechtssicherheit zu begrüßen. Dennoch sollten die kürzlich erfolgten Änderungen des JAG NRW im Hinblick auf mögliche Zusatzbelastungen der Studierenden und einen nachhaltigen Umgang mit Hochschulressourcen evaluiert werden.
6. Zusammenfassung
Zusammenfassend werden folgende Änderungen des Gesetzesentwurfs vorgeschlagen: die Streichung des Erfordernisses der Exmatrikulation vor Stellung des Antrages auf Verleihung eines Bachelor of Laws, die Festsetzung des Stichtages für die nachträgliche Verleihung auf den 31.03.2017, die Unschädlichkeit des Vorliegens einer der beiden Voraussetzungen für die Beantragung des Bachelor of Laws sowie die Sicherstellung einer Beteiligung weiterer Akteur:innen bei Erlass einer Rechtsverordnung.
Daneben sollte darauf geachtet werden, dass der kraft Gesetzes verliehene Bachelor of Laws in gleichem Maße wie ein akkreditierter Bachelor of Laws zur Aufnahme eines konsekutiven Masterstudiengangs sowie zum Einstieg in den Beruf geeignet ist, ein Umrechnungsschlüssel die Eigenarten der juristischen Notenvergabe beachtet und eine Qualitätssicherung des Studiums über die Gesetzesevaluation hinaus erfolgt.
Abgesehen von den angeregten Änderungen begrüßt der Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. den Entwurf des Gesetzes zur Einführung des integrierten Bachelors im Studium der Rechtswissenschaft mit dem Abschluss erste Prüfung sowie betreffend das duale Studium und zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes Nordrhein-Westfalen. Trotz Einführung des integrierten Bachelors darf jedoch nicht aus den Augen verloren werden, dass in der juristischen Ausbildung weiterhin akuter Reformbedarf besteht. Neben einer Evaluation der die Ausbildung regelnden Normen ist daher auch eine grundsätzliche und ständige Evaluation der Ausbildung als solche erforderlich.