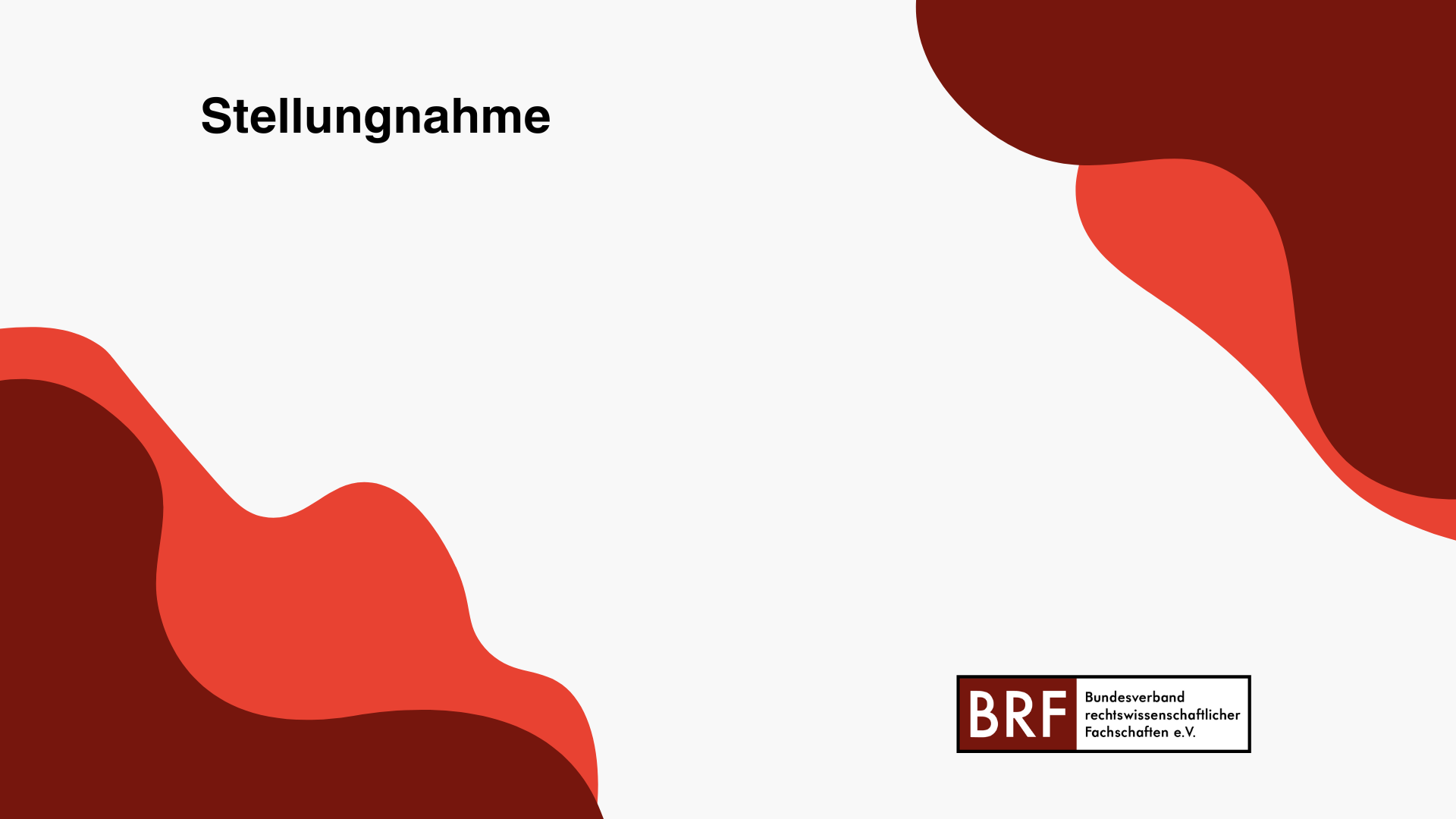20. September 2023
Mittlerweile zeigen zahlreiche Erhebungen und nicht zuletzt der Jurist:innenmangel, dass die juristische Ausbildung reformiert werden muss. Deutlich wird die Reformbedürftigkeit auch anhand der kürzlich erschienenen Ergebnisse der fünften bundesweiten Absolvent:innenbefragung des Bundesverbands rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V.: Nur jede:r dritte Jurastudierende würde das aktuelle rechtswissenschaftliche Studium weiterempfehlen. Doch wo liegen die Probleme und welche Veränderungen braucht es in der juristischen Ausbildung?
Senkung des psychischen Drucks
Dass das Jurastudium anspruchsvoll ist, ist nichts Neues. Inzwischen lässt sich jedoch ein besorgniserregender Wandel erkennen: Der Studiengang Rechtswissenschaft(en) weist hinsichtlich der emotionalen Erschöpfung der Studierenden den zweithöchsten Wert aller Studienfächer auf; 59 % der Jurastudierenden zeigen mindestens einmal in der Examenszeit auffällige Anzeichen von chronischem Stress. 93 % der Absolvent:innen empfinden den Prüfungsdruck in der Zeit vor der staatlichen Pflichtfachprüfung als sehr hoch (Skalenwerte 8 – 10). Hinzu kommt der einzigartige Ablauf des juristischen Studiums: Eine Regelstudienzeit von zehn Semestern und eine Abschlussprüfung, bei der einige Tage über einen Großteil der Abschlussnote entscheiden.
In so gut wie allen anderen Studiengängen wird nach sechs oder acht Semestern der Bachelor absolviert, die bis dahin erbrachten Studienleistungen fließen anteilig in die Endnote ein. Geht man also davon aus, dass im rechtswissenschaftlichen Studium nach derselben Semesteranzahl Studienleistungen erbracht worden sind, die vom Umfang und Anspruch den Leistungen der Bologna-Studiengänge entsprechen, stellt sich die Frage, warum diese Leistungen nicht auch im rechtswissenschaftlichen Studium grundsätzlich mit einem vergleichbaren Abschluss honoriert werden sollten. Stimmt man dieser Annahme nicht zu, sollte die Sinnhaftigkeit des derzeitigen Studienaufbaus grundsätzlich überdacht werden. Ein integrierter Abschluss würde laut 93 % der Absolvent:innen den unverhältnismäßig hohen Prüfungsdruck jedenfalls verringern.
Der hohe psychische Druck und die Unsicherheit, ob die eigenen Leistungen zum Bestehen der ersten juristischen Prüfung ausreichen, belasten die Studierenden nicht nur in ihrem Studium, sondern sorgen auch dafür, dass viele Jurastudierende ihr Studium auch noch kurz vor dem Antritt zur staatlichen Pflichtfachprüfung abbrechen. Ein Viertel dieser Abbrüche geschehen sogar noch nach dem zehnten Semester. Dem Problem, dass Studierende im Zweifel nach mindestens fünf Jahren Studium, in dem sie die geforderten Studienleistungen erbracht haben, ohne akademischen Abschluss dastehen, könnte man durch die Einführung eines integrierten Bachelor of Laws entgegenwirken. Zudem nimmt man den „Alles-oder-nichts-Charakter“ aus der ersten juristischen Prüfung und senkt so die (berechtigte) Angst der Prüflinge, am Ende ohne Abschluss dazustehen.
Reduzierung des Pflichtfachstoffes
Ein weiteres Problem der juristischen Ausbildung ist der Umfang des Pflichtfachstoffes. Dass dieser zu hoch ist, empfinden auch 76,30 % der befragten Absolvent:innen. Dabei stellt sich die Frage, was der Anspruch des Studiums sein sollte. Zwar ist das Ziel, Einheitsjurist:innen auszubilden, diese sollten sich jedoch dadurch auszeichnen, dass sie das Handwerkszeug besitzen, sich auch in ihnen fremde Rechtsgebiete einarbeiten zu können. Schließlich kann die juristische Ausbildung unmöglich all den Stoff abdecken, den Jurist:innen in ihrem gesamten Berufsleben brauchen werden – dem steht schon allein die ständige Weiterentwicklung des Rechts entgegen.
Das scheint aktuell allerdings nicht erkannt zu werden: Die Masse an zu beherrschenden Teilrechtsgebieten und Einzelfallproblemen führt dazu, dass ein Fokus auf systematisches Verständnis und das Anwenden juristischen Handwerkszeugs so gut wie unmöglich wird. Stattdessen fühlen sich Studierende mittelbar gezwungen, auf reines Auswendiglernen zu setzen, um die inhaltlich überladenen Prüfungen in der knapp bemessenen Zeit überhaupt lösen zu können. Wozu auch methodisch an einen Fall herangehen? Strukturelle Herleitungen und eine Argumentation abseits der Lösungsskizze werden im aktuellen System in den wenigsten Fällen honoriert.
Durch neue nationale und internationale Regelungen sowie die Weitentwicklung in der Rechtsprechung wächst der prüfungsrelevante Stoff dazu fast täglich – und das, ohne den Pflichtfachstoffkatalog überhaupt anrühren zu müssen. Dieses rasante Wachstum lässt sich auch anhand der Absolvent:innenbefragungen nachvollziehen: Während 2018 „nur“ 62,7 % der Absolvent:innen den Prüfungsstoff für zu viel hielten, stieg die Zahl 2022 auf 76,3 % an.
All das zeigt: Die Reduzierung des Pflichtfachstoffes ist dringend notwendig. Die Auswahl des prüfungsrelevanten Stoffes sollte dabei nicht einseitig vorgenommen werden, sondern muss nach Abwägung der Argumente der verschiedenen Akteur:innen in der juristischen Ausbildung geschehen, sich auf Kernthemen juristischer Ausbildung fokussieren und in regelmäßigen Abständen evaluiert werden. Eine bundesweite Harmonisierung ist dabei schon allein aufgrund der Chancengleichheit erforderlich.
Förderung von Chancengleichheit
Auch an anderen Stellen besteht hinsichtlich der Chancengleichheit Verbesserungsbedarf: Die Diversität in der Gesellschaft muss sich auch unter den Jurist:innen widerspiegeln. Dazu muss jedoch dafür gesorgt werden, dass der Zugang zur juristischen Berufswelt unabhängig von dem sozialen Hintergrund möglich ist. Erste notwendige Schritte dafür sind die Ermöglichung der Absolvierung der praktischen Studienzeit innerhalb der vorlesungsfreien Zeit und die Einführung von verdeckten Zweitkorrekturen in den staatlichen Pflichtfachprüfungen.
Auch länderübergreifend ist es wichtig, Chancengleichheit zu fördern. Die Notwendigkeit wird durch den Ringtausch der Sachverhalte der Aufsichtsarbeiten in der staatlichen Pflichtfachprüfung noch einmal verstärkt: Werden in verschiedenen Ländern dieselben Klausuren bei unterschiedlichen Prüfungsbedingungen gestellt, kann Chancengerechtigkeit nur schwer erreicht werden. Studierende, denen Markierungen und Paragrafenverweise im Gesetzestext erlaubt sind und/oder die schriftliche Pflichtfachprüfungen bereits elektronisch ablegen können, haben dabei grundsätzlich einen Vorteil gegenüber Studierenden der Länder, in denen dies nicht möglich ist. Auch hier sollte eine Harmonisierung erfolgen, diese darf allerdings nicht zum Nachteil der Studierenden ausfallen. Dabei ist vor allem die Ermöglichung von Gesetzesmarkierungen und -verweisen zu befürworten: Sie sorgen für ein Zeitersparnis in der Aufsichtsarbeit, fördern das Systemverständnis und entsprechen der juristischen Praxis.
Notwendigkeit einer zeitgemäßen juristischen Ausbildung
An der mittlerweile über 150 Jahre alten Struktur der juristischen Ausbildung wurden und werden nur marginale Veränderungen vorgenommen. Dabei wird der Reformbedarf in einigen Punkten durchaus gesehen. Doch die Änderungen in den Ausbildungsgesetzen und -verordnungen, die in letzter Zeit beschlossen wurden, sind mehr als fragwürdig: Die Einführung einer siebten Klausur in Schleswig-Holstein, die Abschaffung des freischussunabhängigen Verbesserungsversuchs in Bremen und die (inzwischen zurückgenommene) Streichung der prüfungsfreien Tage in der staatlichen Pflichtfachprüfung sorgen lediglich für eine stärkere Belastung der Studierenden.
Insbesondere durch die finanziell bedingte Bindung an den Ringtausch der Klausuren und dem gemeinsamen Pflichtfachstoffkatalog heißt es in den Ländern bei jeder noch so kleinen Forderung nach einer Reform, man könne das nicht alleine durchsetzen. Während also die Harmonisierung als Grund genannt wird, keine eigenen Entscheidungen treffen zu können, wird in einigen Bundesländern gleichzeitig zulasten der Studierenden wieder von den einheitlichen Prüfungsbedingungen abgewichen. Gut ausgebildete Jurist:innen stellen einen elementaren Bestandteil eines funktionierenden Rechtsstaats dar. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, brauchen wir eine zeitgemäße und realitätsnahe juristische Ausbildung. Dieses Ziel wird aktuell um Längen verfehlt. Es ist Zeit, die Ausgestaltung des rechtswissenschaftlichen Studiums einer kritischen Prüfung zu unterziehen.