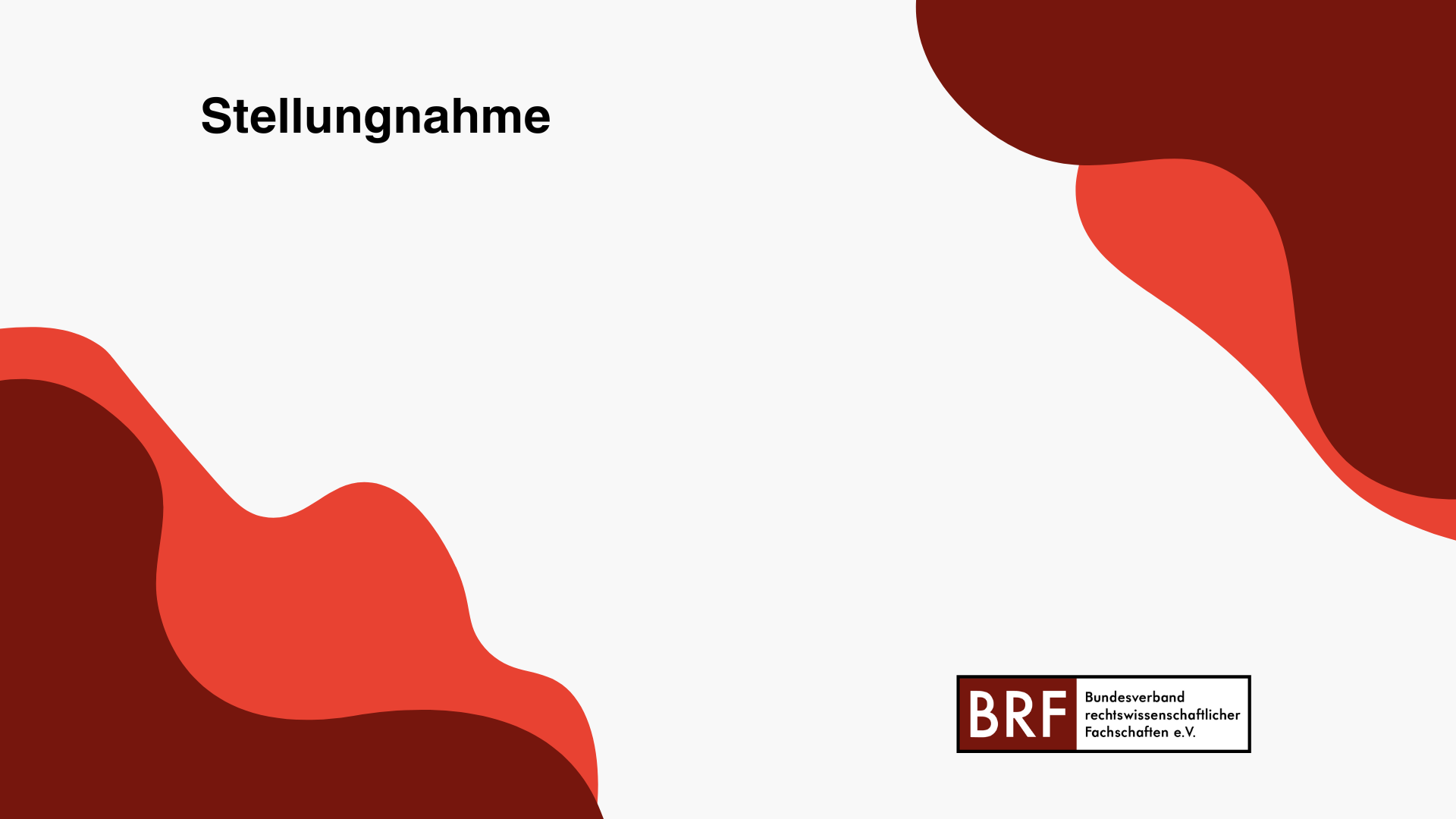16. Juli 2025
In den Hörsälen der juristischen Fakultäten der Bundesrepublik wird vermittelt, auch unbequeme Positionen zu prüfen, zu akzeptieren oder fundiert zu widerlegen. Genau das muss auch auf der Richterbank gelten. Die juristische Ausbildung lebt von Vorbildern, die juristische Präzision mit persönlicher Haltung verbinden. Prof. Dr. Brosius-Gersdorf ist für viele von uns genau ein solches Vorbild. Der Umgang mit ihrer Nominierung ist daher auch ein Prüfstein für die Wertschätzung unabhängiger und selbstbewusster juristischer Stimmen in Deutschland.
Die öffentliche und politische Debatte rund um die gescheiterte Wahl von Prof. Dr. Frauke Brosius-Gersdorf zur Richterin des Bundesverfassungsgerichts wirft grundlegende Fragen auf – über die Autonomie von juristischer Expertise, der politischen Kultur und der Integrität höchstrichterlicher Instanzen.
Als Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften (BRF) sehen wir in der Art und Weise dieses Verfahrens einen gefährlichen Präzedenzfall – für das juristische Selbstverständnis wie für das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit und Unabhängigkeit des Rechtsstaates. Ali Sahan, der Vorsitzende des BRF, erläuterte hierzu: „Wenn juristische Exzellenz und Erfahrung hinter parteipolitischen Erwägungen zurücktreten müssen, stellt das nicht nur die Integrität des Auswahlverfahrens infrage – es sendet auch ein fatales Signal an kommende Generationen junger Jurist:innen, die an den Rechtsstaat glauben.“
Prof. Brosius-Gersdorf ist eine profilierte und hochqualifizierte Staatsrechtlerin mit jahrzehntelanger universitärer und wissenschaftlicher Erfahrung. Sie ist Autorin zentraler Lehrwerke, Kommentare und Gutachten im Verfassungs- und Verwaltungsrecht. Ihre Arbeiten prägen mitunter unsere Ausbildung – ihre Argumentationen begegnen uns in Lehrveranstaltungen, Examensklausuren und Seminaren. Dass eine solche Kandidatin nicht an juristischer Eignung, sondern aufgrund parteipolitischer Motive und ideologisch aufgeladener Hetzkampagnen scheitert, lässt gerade beim juristischen Nachwuchs Zweifel an der Fairness und Unabhängigkeit des Verfahrens aufkommen – insbesondere an den juristischen Nachwuchs. Besonders problematisch sind die Entwicklungen für angehende Juristinnen in der Ausbildung und deren Karrierewegen: Schon wieder werden an eine hochqualifizierte Frau Maßstäbe angelegt, die für Männer nicht gelten. Schon wieder wird einer meinungsstarken Frau ein ihrer Qualifikation entsprechendes Amt verwehrt.
Wenn juristische Klarheit, fachliche Tiefe und die Fähigkeit zur eigenständigen Argumentation nicht mehr ausreichen, um ein solches Amt zu erreichen, wird ausgerechnet das Bundesverfassungsgericht, welches bislang für Unabhängigkeit, Differenzierungen und eine Vielfalt an rechtswissenschaftlichen Zugängen stand, in seiner Legitimität beschädigt.
Statt fachlicher Tiefe und wissenschaftlicher Integrität scheint politisches Kalkül und Angst vor rechten Meinungsmachern den Ausschlag zu geben. Das widerspricht dem Geist der Verfassung und den Maßstäben, welche wir in der juristischen Ausbildung tagtäglich vermittelt bekommen.
Noch bedenklicher ist: Wenn dieses Vorgehen zur gängigen Praxis wird, steht nicht nur das Richterwahlverfahren zur Disposition – sondern das Gericht selbst. Wird die Auswahl künftig davon abhängig gemacht, ob Kandidat:innen vorhersehbar „anschlussfähig“ im politischen Diskurs sind, droht ein Verlust an Pluralität, intellektueller Unabhängigkeit und dogmatischer Tiefe.
Das Bundesverfassungsgericht lebt von der juristischen Vielfalt auf der Richterbank und ihrer Fähigkeit zum Konsens – nicht von der politischen Unauffälligkeit ihrer Mitglieder:innen. In einer Demokratie sollte sie im besten Fall auch die Diversität gesellschaftlicher Perspektiven widerspiegeln.
Gerade in der juristischen Ausbildung lernen wir: Das Verfassungsgericht ist mehr als nur ein Organ der Normenkontrolle. Es ist das Symbol für Rechtsstaatlichkeit, Maß, sowie Garantin unserer Grundrechte. Die derzeitige Debatte stellt dieses Selbstverständnis infrage.
Ferner berührt sie die Frage, wie wir als Gesellschaft mit der Unabhängigkeit der Justiz umgehen, ob wir bereit sind, Rechtsstaatlichkeit auch dann zu verteidigen, wenn sie der vorherrschenden Meinung nicht folgt. Wer Richter:innen ablehnt, weil sie juristisch argumentieren, statt politisch zu gefallen, beschädigt langfristig das Vertrauen in unser höchstes Gericht und der Rechtstaatlichkeit selbst.